|
Wissenswertes aus der Imkerei |

|
| |
Die 3 Bienenwesen |
Die Varroamilbe |
Imkerei im Jahreskreis |
Geschichte der Imkerei |
Honigwein |
Aktuelles aus meiner Imkerei |
Bienenwachs |
Neues über Honig, Propolis u.a. |
|
Aktuelle Nachrichten aus aller Welt |
|
Warum gibt in Österreich immer weniger Bienen? |
|
|
Die 3 Bienenwesen |
Ein Bienenvolk besteht aus
- Der Bienenkönigin
- Den Arbeitsbienen
- Dem Wabenbau
- Dem Futtervorrat
|
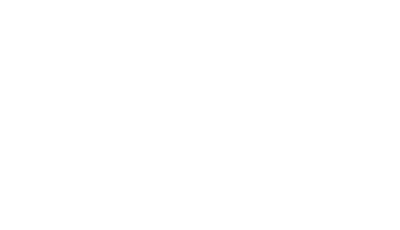
|
Die Königin
ist das einzige eierlegende Weibchen im Bienenvolk. Sie geht aus einem
begatteten Ei hervor. Die Entwicklungszeit der Königin vom Ei bis zum
Schlüpfen beträgt 16 bis 17 Tage. 3 Tage Ei, 6 Tage Made, 7 bis 8 Tage
Umwandlung bis zum Schlüpfen der Jungkönigin. Sie wird während ihrer
Brunft, günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, bei ihrem ersten
Ausflug von bis zu zwanzig Drohnen begattet. Die Nachkommen von
einer Königin sind untereinander Halbgeschwister. Die Königin kann ein
Alter bis zu 6 Jahren erreichen. Junge Bienenköniginnen können bis zu
2.500 Eier pro Tag legen. Durch Aussenden von Botenstoffen, sog.
Pheromonen „lenkt“ eine Königin das Leben im Bienenvolk. Eine „alte“
Königin verliert langsam diese Eigenschaften, deshalb wird sie von
ihrem Volk oder vom Imker ausgetauscht.
Die Drohnen
sind die Männchen im Bienenvolk. Im Gegensatz zu den Arbeiterinnen
haben die keinen Stachel, sind größer und plumper als diese und
sindleicht an den großen, zusammenliegenden Facettenaugen zu erkennen.
Sie gehen aus unbesamten Eiern hervor, haben also keinen Vater und sind
daher Halbwesen. Die Entwicklung des Drohns währt am längsten, nämlich
24 Tage, und zwar 3 Tage Eistadium, 6 Tage Made und 15 Tage Umwandlung.
Drohnen werden - vom Ei an gerechnet - um den 35. Tag geschlechtsreif.
Darauf ist bei der Königinnenzucht grundsätzlich zu achten! Drohnen
erscheinen in den Völkern von etwa Mitte April bis Ende August. Von
weiselrichtigen Völkern werden sie Ende des Sommers aus den Völkern
verdrängt - "Drohnenschlacht." Sie
überwintern daher unter normalen Verhältnissen nicht, sie wären nur
unnötige Verbraucher des Winterfutters. Der Zweck der Drohnen ist,
jungfräuliche Königinnen zu begatten. Diese Aufgabe können sie nur
einmal erfüllen, weil sich dabei ein Teil ihres Geschlechtsapparates
von ihnen trennt, nämlich im Geschlechtsvorhof der Königin zurückbleibt
- Begattungszeichen. Daher
gehen die Drohnen beim Begattungsakt zugrunde. Die Begattungszone nennt
man "Drohnensammelplatz", an dem sich die brünftigen Drohnen einer
Gegend sammeln. Die Königinnen fliegen dorthin und werden im Flug von
den kräftigsten und schnellsten Drohnen begattet.
Die Arbeitsbiene oder Arbeiterin
ist das Produkt von Königin und Drohn; sie geht aus einem befruchtetem
Ei hervor. Ihre Entwicklung währt 21 Tage. Die Entwicklung vom Ei bis
zur schlüpfenden Biene währt etwa 21 Tage, und zwar 3 Tage Ei, 6 bis 7
Tage Made 11 bis 12 Tage Umwandlung zum fertigen Insekt. Die
Arbeitsbienen haben sämtliche Arbeiten zu besorgen, wie das Säubern der
Zellen, die Pflege der Königin, das Ernähren und Erwärmen der Brut, die
Wachserzeugung und den Zellenbau, das Säubern und Lüften der Behausung
des Volkes, den Wachdienst vor dem Flugloch, das Verteidigen des Volkes
gegen Feinde und das Sammeln von Pollen, Nektar, Wasser und Kittharz.
Bei den Arbeiterinnen unterscheiden wir
Sommer- und Winterbienen. Sommerbienen erreichen ein Alter von
höchstens 6 Wochen, Winterbienen werden hingegen 6 bis 8 Monate alt.
Während der Hochentwicklung birgt ein Volk bis zu 60.000 Bienen,
wintersüber etwa 8000 bis 12.000.
Die Arbeitsbienen leben in den Sommermonaten nur 4-8 Wochen, dann sind sie abgearbeitet:
Nach dem Schlüpfen haben sie ihre Zelle zu putzen – wie ordentlich!
Anschließend sind sie bereits zur Fütterung der älteren Larven mit dem
„klaren Futtersaft“ - bestehend und Nektar und Pollen- befähigt. Wenn
nach einigen Tagen ihre Futterdrüsen aktiviert sind, haben sie die
jüngeren Larven, bzw. die Weiselzellen mit dem „weißen Futtersaft“ zu
versorgen. In der Folge nehmen sie bereits Nektar von den
Honigsammmelbienen entgegen, versetzen ihn mit Drüsensekreten und
lagern ihn in Zellen. Nektar wird einige Male umgetragen und durch
Reduktion des Wassergehaltes zu Honig eingedickt. Wenn die Wachsdrüsen
nach wenigen Tagen aktiviert sind, schwitzen sie zwischen
Hinterleibsringen kleine Wachsplättchen aus und bauen die Zellen. Nach
kurzer Zeit ist die Giftdrüse aktiviert und die Bienen können
Wächterdienste am Flugloch übernehmen, ehe sie als Sammelbiene
eingesetzt werden. Wenn sie dann abgearbeitet sind, taugen sie noch
wenige Tage als Wasserträger, ehe sie außerhalb des Bienenvolkes
absterben.
Bienenschwärme
bezeichnet man als die ungeschlechtliche Vermehrung der
Bienenvölker. Wenn eine Königin (Weisel) alt ist, und deshalb nur mehr
geringe Duftstoffe = Pheromone aussendet, oder wenn im Bienenvolk
Platzmangel herrscht, werden von den Bienen Weiselzellen angesetzt, in
denen Jungköniginnen herangezogen werden. Weisellarven und Königinnen
werden mit Gelee Royale, Honig vermischt mit Pollen und einem
speziellen Drüsensekret der Jungbienen, alles zusammen ist der
eiweißreiche "weisse Futtersaft," gefüttert. Vor dem Schlüpfen dieser
Jungköniginnen „schwärmt“ die Altkönigin mit den Altbienen und gründet mit Ihnen ein neues Bienenvolk. In der Regel tötet die erste geschlüpfte Jungkönigin
die anderen noch in ihren Weiselzellen. Es kommt aber auch vor, dass
sich gleichzeitig geschlüpfte Jungköniginnen einen Kampf liefern, die
stärkere überlebt. Wenn eine oder mehrere Jungköniginnen dem
Schwesternmorden entgehen und mit einem Teil der verbliebenen Bienen
abschwärmen, nennt man es Nach- oder Jungfernschwärme. Mehrere solcher
Schwärme können ein Bienenvolk so gewaltig schwächen, dass der Imker
von diesem Volk keinen Honigertrag mehr hat. Jungköniginnen fliegen zur Begattung
nur 1 x aus, und erhalten von zehn bis zwanzig Drohnen so viele
Spermien, dass sie dadurch bis zu 6 Jahre begattete Eier legen
können. Aus den besamten Eiern entstehen Arbeiterinnen und bei
Bedarf Königinnen, aus unbegatteten Eiern Drohnen. Bei der Eilage misst
die Königin mit ihren Vorderbeinen den Zellendurchmesser ab, in die
größeren Drohnenzellen, werden die unbesamten Eier gelegt. Eine gute
Königin kann infolge der Fütterung mit Gelee Royale täglich bis
zu 2500 Eier legen, das Gewicht derselben übertrifft ihr eigenes
Körpergewicht.
|

|
|
Imkerei im Jahreskreis
|
Ein
Bienenjahr beginnt im Herbst, wenn die Bienenvölker nach der letzten
Honigentnahme für den Winter aufgefüttert werden und die „Winterbienen“
bilden. Diese Bienen haben eine stärkere Eiweißschicht aufgebaut und
müssen keine Arbeiten im Bienenvolk übernehmen. (Bild: Bienenvölker im
Winter)
Dadurch leben sie bis zu 7-8 Monate. Im Winter zieht sich das Bienenvolk in den Wabengassen zu einer „Wintertraube“ zusammen. |
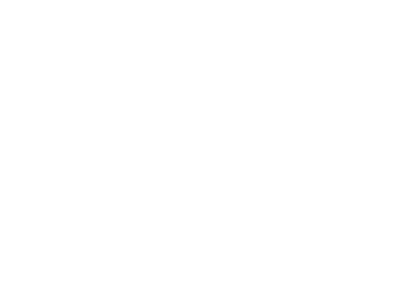
|
In
der geschützten, warmen Mitte hält sich die Bienenkönigin auf.
Durch Muskelzittern erzeugen die Bienen im Winter eine Temperatur bis
zu 34 Grad. Im Frühjahr werden als erstes die Haseln, Erlen, Weiden und Pappeln angeflogen, mit deren Pollen und Nektar werden die neu entstandenen Jungbienen gefüttert. |
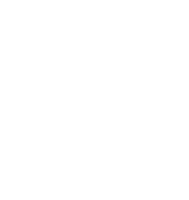
|
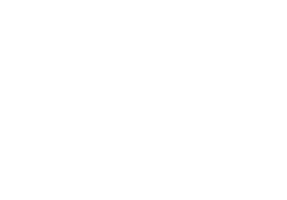
|
Ab Februar/März, von der Aussentemperatur abhängig, nimmt die Anzahl der Bienen stark zu. Haben ca. 10.000 Individuen im Bienenvolk überwintert, steigt die Volkstärke bis Mai auf ca. 60.000. Zu dieser Zeit legt die Bienenkönigin am Tag bis zu 2.500 Eier. Dazu wird sie auch ununterbrochen mit dem Weiselfuttersaft gefüttert.
In
den folgenden 3 Monaten nützen die Bienen die Trachtangebote ihres
Flugbereiches. Unter "Tracht" versteht der Imker verstärktes
Nektarangebot in der Natur. Wenn der Honigraum gefüllt wurde und der Honig gereift ist, also die Waben vollständig verdeckelt wurden, kann der Honig geerntet werden. Die leeren Waben können wieder den Bienenvölkern zugehängt werden.
So kann der Imker erkennen, von welchen Blüten der jeweilige Honig
kommt. "Reif" ist ein Honig, wenn die Waben ganz oder mehrheitlichnvon
den Bienen mit einer konservierenden Wachsschicht überzogen wurde.
Wenige
wissen , dass für 1 Kilo Honig die Bienen bis zu 150.000 mal ausfliegen
und dabei bis zu 20 Millionen Blüten besuchen müssen. Dabei legen sie
bis zu 150.000 Flugkilometer zurück (fast 4 x rund um die Erde).
Außerdem sind weitere ca. 100.000 Flüge
erforderlich, um Blütenpollen, Propolis und Wasser einzubringen.
Blütenpollen mit Honig vermischt wird den Bienenlarven als Nahrung
gefüttert, während Propolis zur Infektionsvorbeugung und zum Abdichten
von Ritzen dient. Wasser verwenden die Bienen im Frühjahr, um das von
ihnen eingedickte, und dadurch haltbar gemachte Winterfutter zu
verdünnen, und im Sommer zur Regulierung der Temperatur im Bienenstock.
Wassertröpfchen werden im Bienenstock so platziert, dass es durch
Luftfächeln der Bienen verdunstet, somit erzeugen sie Verdunstungskälte.
|

|
Die Varroamilbe
|
Die
„Geisel“ der heutigen Imkerei. Diese Milbe hatte bis vor 20 Jahren nur
die asiatischen Honigbienen befallen und richtete dort keinen
nennenswerten Schaden an. Durch unglückliche Umstände gelangte sie in
den 1980er Jahren nach Europa und verbreitete sich binnen weniger Jahre
nahezu flächendeckend über die europäischen Bienenvölker. Unsere
heimischen Bienen erkennen diese Milbe noch nicht als Feind und können
ihn nicht bekämpfen. Die Varroamilben sind dunkel- bis hellbraun, oval
und ist nur 1,2 mm groß. Sie werden durch Drohnen, die oft weite
Strecken zurücklegen und in jedem Bienenvolk willkommen sind,
übertragen. Dort schlüpfen die Weibchen unmittelbar vor der
Verdeckelung einer Brutzelle zu der werdenden Jungbiene. In der Zelle
beginnt diese Milbe sofort mit der Eilage. Von den 5-6 Eiern schlüpft
aus dem zweiten ein Männchen, das noch in der Zelle die geschlüpften
Weibchen begattet. Die Milben stechen die Bienenlarve mit ihrem
Saugrüssel an und ernähren sich von deren Lebenssaft. Dadurch wird die
nach ca. 12 Tagen schlüpfende Jungbiene massiv geschwächt. Auch
erwachsene Bienen werden von der Milbe angestochen, diese saugen ihre
Hämolymphe. Die geschwächte Biene kann den ihr zukommenden Arbeiten nur
ungenügend nachkommen und stirbt früher ab. Bei massivem Varroabefall
kann das gesamte Bienenvolk eingehen, was leider sehr häufig in den
Wintermonaten vorkommt.
Was
kann der Imker gegen diese Milbe tun: um das kostbare Lebensmittel
Honig nicht zu beeinträchtigen, dürfen nur Maßnahmen gesetzt werden,
die keine Rückstände im Honig hinterlassen. In den Sommermonaten werden
zuerst Drohnenwaben ausgeschnitten und vernichtet, denn die Milbe
befällt vornehmlich die Drohnenlarven wegen ihres höheren
Juvenilgehalts. Weiters werden zur Bildung von Jungvölkern Waben mit
Arbeiterinnenbrut entnommen. Alle diese Maßnahmen dezimieren den
Milbenbefall im Bienenvolk so nachhaltig, dass die Schadschwelle nicht
erreicht wird. Diese Jungvölker sind in der Folge im Aufbau
begriffen und bringen im gleichen Jahr keinen Honig mehr ein, der
geerntet werden kann. Im Herbst, nach der letzten Honigentnahme können
die Bienenvölker zusätzlich mit von der Behörde zugelassenen
organischen Säuren behandelt werden. Diese töten die Milben, schädigen
aber nicht die Bienen und sind nach wenigen Wochen unter der
Nachweisgrenze abgebaut. Als verantwortungsbewusster Imker bringe
ich keine Chemie ins Bienenvolk ein, wie das leider wiederholt im Ausland passiert!
|

|
Geschichte der Imkerei
|
Die Geschichte der Imkerei:
Aus Felszeichnungen der Höhle von Arana, Spanien wissen wir, dass Honig
schon in der Steinzeit begehrt war. Damals glaubte man, dass Honig als
Tau vom Himmel falle. Seit dem 3. Jtd v. Chr. finden wir in ägyptischen
Pharaoinschriften die Biene als Königshieroglyphe, als
Hoheitszeichen unserem Bundesadler vergleichbar. Die Könige der
Babylonier, Rimusch von Akkadien (2.500 v. Chr.), später Hammurabi
(1700 v. Chr.) opferten dem Sonnengott Honig. Ins "gelobte Land", in
dem Milch und Honig
fliessen, führte Moses sein Volk, später opferten die Juden die erste
Honigernte des Jahres dem Herrn. An über 60 Stellen in der Bibel wird
Honig erwähnt, das zeigt seinen hohen Stellenwert. Die historischen
Juden kannten auch seine Heilkräfte: Honig und Milch
galten als vorzügliche Nahrung für Kleinkinder. Man verwendete Honig
gegen Herzbeschwerden, Gicht, Rheuma und als Wundauflage bei Mensch und
Tier.
Bei den Griechen war Honig "die liebliche Speise der Götter." Ambrosia,
die Götterspeise, die Jugend und Unsterblichkeit verleiht, wurde aus
Milch und Honig bereitet. Ambrosia war auch das Salböl der Götterwelt,
das die Schönheit des Körpers erhöht und selbst Tote vor Verwesung
schützt. Der oberste Gott Zeus wurde
von Nymphen mit Honig und Ziegenmilch aufgezogen. Seine Erzieherin war
die Honignymphe Melissa. Sie gilt als die Erfinderin des Mets, Zeus
selbst war ein Mischkünstler dieses Honigweins. Auch viele andere
griechische Götter und Halbgötter werden im Zusammenhang mit Honig
genannt. Opfer an die Götter waren oft Früchte, die mit Honig
bestrichen waren.
Der berauschende Honigmet
wurde früher als „Wein“ bezeichnet, häufig wurde er bei besonderen
sakralen Feiern getrunken. Der berühmteste Arzt der Antike, Hippokrates
(460-377 v. Chr.), der "Vater der Medizin" nannte Honig seine liebste
Medizin: er heilte damit eiternde Wunden und gab ihn bei Fieber. Seine
Anhänger, die Hippokratiker kannten mehr als 300 Honigrezepte,
60 davon waren Getränke. Homer (8.Jht.v.Chr), Euripides (5.Jht.v.Chr.)
bei den Griechen, Ovid, römischer Dichter zur Zeitenwende und viele
andere antike Dichter schilderten die Heil-und Nährkräfte des Honigs.
Sehr geschätzt wurde auch der "Sauerhonig", eine Mischung aus Honig,
Wasser und Essig, der Wohlbefinden erzeugte. Auch heute wird Honig mit
Apfelessig in Wasser gemischt, und als „Lebenselixier“ getrunken.
Die Römer
hatten auf ihren Landwirtschaftsbetrieben eigene Imkersklaven, die den
Bienenstand betreuten. Gerne wurden Früchte, von Quitten bis zu Oliven
in Honig konserviert. Die Ärzte kannten viele Heilgetränke, die mit
Honig bereitet wurden. Sie empfahlen, täglich am morgen Honig zu essen,
„dann bliebe man sein Leben lang gesund.“ Der hundertjährige Philosoph
Demokrit nannte sein Rezept: äußerlich Öl und innerlich Honig. Kaiser Augustus wiederum erhielt den Rat, "wenig Fett, aber viel Honig zu essen."
Weil man die Biene als jungfräulich geboren betrachtete, brachte man
sie im frühen Christentum mit Christus, Maria und den hl. Jungfrauen in
Verbindung. "Jungfräulich" deshalb, weil man die Bienenkönigin oft als
"Bienenkönig" bezeichnete, der ohne Zeugungsakt die Zahl der Bienen
vermehren konnte. Nach Matth.3,4 aß Christus selbst nach seiner Auferstehung vor den Augen seiner Jünger Fisch undein Stück Honigwabe. Lange Zeit wurden Milch und Honig am Karsamstag und am Pfingstsamstag gesegnet und Täuflingen gegeben.
Während in den Mittelmeerländern Bienen vor 2000 Jahren häufig schon in Körben gehalten wurden, kannten die Germanen
lange Zeit nur die Waldbienennutzung: ganze Sippen "bewirtschafteten"
Bäume, in denen sich Bienen niedergelassen hatten. Auch bei ihnen
galten die Bienen als besonders rein, weshalb nur Männer Bienenväter
sein durften (wegen der allmonatlichen "Unreinheit" der Frau). Honig
war bei den Germanen die Götterspeise, von der heiligen "Weltesche"
träufelte er zu Boden, die Bienen nährten sich von ihm. Göttervater
Odin verdankte ihm sein Leben, seine Kraft und seine Weisheit. Die
Priester konnten den Göttern besser dienen, wenn sie vom Honigwein
berauscht waren. Welchen Stellenwert Honig und Bienen zu dieser Zeit
hatten; ergibt sich aus der Tatsache, dass der Königsmantel von
Frankenkönig Childerich ( gest. 481 n. Chr.) mit 300 Bienen aus Gold
besetzt war. Sie finden' sich am Krönungsornat Napoleon I. wieder.
Honigzins war übrigens eine der ältesten Steuerformen.
Die Wildbienennutzung wurde bei den Germanen streng geregelt: wer ein
Bienenvolk im Wald entdeckt hatte, durfte den Baum markieren und hatte
damit das alleinige Recht, Honig und Wachs daraus zu ziehen. Die "Zeidler"
wie die Imker im Mittelalter hießen und ihre "Zeidelweid", ihre
"Bienenbäume", wurden geschützt: "Man soll keine Bienenbäume schwenden,
oder sonst der Zeidelweid zu nahend hauen."
In
der Nähe von Amstetten, NÖ. liegt in der gleichnamigen Marktgemeinde
das Schloss Zeillern, das in seinem Wappen einen Bienenkorb mit drei
Bienen zeigt. Dieser Ort wird im Jahr 1140 erstmals urkundlich erwähnt
und hieß damals "Zidelaren"; das soviel bedeutet, wie "bei den
Zeidlern." Schon 862 wurde der nahe gelegene Zeitelbach als
"Zidelaribach" erwähnt: Kaiser Ludwig der Deutsche bestätigte dem
"Kloster Niederalteich, dass dieses von Karl dem Großen ein
Gebiet zwischen Donau, Ybbs und Url übertragen erhalten hatte. Meist
wurden mit den landwirtschaftlichen Gütern auch einige "Zeidler"
mitübertragen, die wie im Falle Niederaltaich vor allem für den Bedarf
des Klosters Wachs zu liefern hatten.
Wie zu ersehen ist, hat die Imkerei in unseren Breiten lange Tradition.
Hatten die Römer einst neidisch auf das Gebiet jenseits der Alpen
geblickt, in dem der Honig reichlich geflossen sein soll, so hat sich
die Situation in den letzten Jahrhunderten grundlegend geändert: durch
die industrielle Zuckergewinnung aus Zuckerrohr und Zuckerrübe im
19.Jht. war Honig nicht mehr das alleinige Süßmittel. Viele Wälder
wichen Ackerflächen, auf den Monokulturen finden die Bienen kaum
Nahrung. Mit den Grundzusammenlegungen sind oft die letzten Weg- und
Ackerraine verschwunden. Die verbliebenen Wälder, oft sterile
Fichtenkulturen werden penibel durchforstet. Wo sollte sich da noch ein
hohler Baum für einen Wildbienenschwarm finden?
Die heimischen Imker garantieren mit ihrer Bienenhaltung den Weiterbestand
der Bienen, die seit Jahrmillionen in unseren Breiten heimisch sind.
Bienen sind die einzigen Staatenbildenden Insekten, die vor allem zur
Blütezeit der wichtigsten Kultur- und Wildpflanzen im Frühjahr in
ausreichender Population zur Bestäubung vorhanden sind. Unsere
Obstbäume würden wenig bis keine Früchte tragen, Kulturpflanzen wie
Raps und Sonnenblumen würden oft unzureichend bestäubt, Wildpflanzen
sich ohne Bienenbestäubung. nicht mehr vermehren können. Ohne Bestäubung durch die Bienen würde das heimische Ökosystem verarmen, ihre Flora, und damit die Fauna stark reduziert.
In Österreich wird die Imkerei auch als Hobby betrieben (einem Hobby
geht man in seiner Freizeit. nach Lust und Laune nach) -
ernstzunehmende Bienenwirtschaft erfordert aber vornehmlich Handeln
nach den Bedürfnissen der Bienenvölker und den jeweiligen klimatischen
Bedingungen. Imkerei ist ernstzunehmender landwirtschaftlicher Haupt-
oder Nebenerwerb.
Imker sind oft Idealisten, denn der Aufwand in der Bienenhaltung ist
mit dem Honigertrag selten in Relation zu stellen. Und dennoch freut
sich der Bienenvater, wenn er seinen oft hart erarbeiteten, manchmal
kärglichen Honigertrag verkauft, um zumindest seine Ausgaben
abzudecken. Der heimische Imker spürt den harten Wind der Konkurrenz
der Honigbilligimporte aus Übersee. Schmerzlich muss er feststellen,
dass der Kunde Honig oft nicht nach Qualitätskriterien, sondern vor
allem in Supermärkten Auslandshonig aufgrund des niedrigen Preises
kauft. Infolge geschickter Aufmachung ist den Konsumenten oft gar nicht
bewusst, dass es sich dabei gar nicht um inländischen Honig handelt,
wenn er „in Österreich abgefüllt" wurde.
Es ist ein wichtiges Anliegen der heimischen Imker, diesen Unterschied dem Konsumenten verständlich zu machen. |
|
|
Honigwein = Met
|
Ihnen vielleicht bisher nur bekannt aus dem Kreuzworträtsel oder als Asterix’ Wundertrank.
Honigwein
war bei allen alten Kulturen bekannt. Der Weinstock wird erst in der
älteren Steinzeit erwähnt, gegorene Honiggetränke wurden mit Sicherheit
aber schon viel früher zu Festen und bei Götteropfern getrunken. Dieser
berauschende Trunk, der bei den Griechen Nektar und Ambrosia hieß,
verlieh den Göttern Unsterblichkeit. Die Altvorderen schrieben ihm
stärkende, gesundheits-fördernde, Potenzsteigernde und
lebens-verlängernde Wirkung zu. Die Germanen schätzten ihn, weil sie
durch ihn Gesundheit, Kraft und Mut zu erlangen glaubten. |
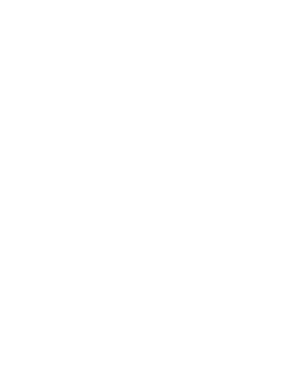
|
Der
Naturheilkundler Sebastian Kneipp sagt über Met: „Met tut viel Gutes,
er bewirkt einen guten Appetit, fördert die Verdauung, reinigt und
stärkt den Magen, schafft ungesunde Stoffe weg, befreit von dem was für
den Körper nachteilig ist. Seine Wirkung ist günstig für das Blut, die
Säfte, Nieren und Blase, weil er überall reinigt, auflöst und
ausleitend wirkt. Für die Alten, so auch für uns ist Met ein
Stärkungsmittel. Er erfrischt und kräftigt die Natur und die kann ihn
brauchen. Die Germanen erfreuten sich einer außerordentlichen
Gesundheit und erreichten ein hohes Alter. Beides, Gesundheit und hohes
Alter verdankten sie besonders ihrem Met.“Worauf beruht nun die
Wirkung dieses Göttergetränks: Met enthält alle die wertvollen
Inhaltstoffe des Honigs. Darüber hinaus wir durch den im Gärprozess
erzeugten Alkohol Propolis aufgenommen, das in dem leicht alkoholischen
Getränk in geringen Mengen gelöst seine positive Wirkung im
menschlichen Organismus entfalten kann.
Honig
wird mit Wasser und Gewürzen - das Mischungsverhältnis und die
Ingredienzien sind bestgehütetes Geheimnis, in Imkereien oft über
Generationen überliefert - von speziellen Hefen zur Gärung gebracht,
reift einige Monate und wird dann in Flaschen abgefüllt. Honigwein ist
entweder süß, halbsüß oder trocken, je nachdem, welche und wie viel
Honiganteile angesetzt werden. Trockener Met ist dem Wermuts, süßer den
Dessertweinen, wie z.B.: Malagawein ähnlich. Getrunken wird er auf ca.
7 Grad gekühlt, am besten in Dessertweingläsern, ev. auch in Stamperln.
Met schmeckt köstlich, er eignet sich hervorragend als Apertitiv, oder
wird auch vor dem Einschlafen getrunken, denn der in ihm enthaltene
Honig beruhigt. Als Longdringbasis kann er z.B. mit Sodawasser oder
Fruchtsäften verlängert werden.
Lagern
Sie die Metflasche bitte kühl und dunkel, aber auch aufrecht stehend,
die im Honig enthaltenen Substanzen könnten Korkgeschmack
annehmen.
Prost! Gesundheit!
|
Bienenwachs
|
Wachs
"schwitzen" Jungbienen zwischen den Hinterleibsringen aus speziellen
Wachsdrüsen aus. Chemisch gesehen ist Wachs ein Fettsäureester. Sein
Schmelzpunkt liegt bei 64 Grad C. Mit dem Wachs bauen die Bienen ihre
sechseckigen Zellen zu Waben, wobei für eine Zelle an die hundert
Wachsplättchen benötigt werden. Eine Arbeiterinnenzelle hat einen
Durchmesser von 5,4mm, davon passen ca. 850 auf einen Quadratdezimeter.
Eine Drohnenzelle misst 6,7mm. Die Sechseckform ist die Platz
sparendste Form, außerdem die stabilste. Wachs enthält nahezu 100 x mehr Vitamin A (Sehkraft, Haut, Finger- und Fußnägel) als z.B. Rindfleisch. Daher ist das Essen von Wabenhonig pur oder gerührt als „Bienenkuss“ sehr gesund.
Aus
Bienenwachs gefertigte Kerzen verströmen einen angenehmen, natürlichen
Duft nach Wachs und Honig. Im Gegensatz zu parfumierten Kerzen aus
Erdölderivaten ist das Abbrennen von Bienenwachskerzen unbedenklich. |
|
Aktuelles aus meiner Imkerei
|
|
Infolge des Klimawandels ist das Imkern im Weinviertel immer schwieriger und weniger ertragreich geworden.
Milde
Winter mit wenig Niederschlägen im Osten des Landes führten immer häufiger im Februar
und März zu einer sehr guten Entwicklung der Bienenvölker, die mit dem
Angebot in der Natur leider nicht im Gleichklang war. Infolge von
wiederholten Frosteinbrüchen erfroren die Blüten vieler Obstbäume,
sodass weder von der Marillenblüte noch von anderem Steinobst Nektar
oder Pollen eingebracht werden konnten. Auch die Rapsblüte konnte von
den Bienen infolge der Trockenheit und kühlen Temperaturen nicht
genutzt werden.
Wenn die Robinie (Akazie) zu blühen begann,
vernichteten Nachtfröste häufig die Absonderung von Nektar. Den
Klimawandel begannen die Bienen auch durch extrem heiße Frühsommer zu
spüren, weil das Nektarangebot in der Natur plötzlich abbrach. Der von vielen Pflanzen ausgebrachte Nektar
vertrocknete, ehe ihn die Bienen sammeln konnten. Die Landwirte hatten
seit jeher von der Befruchtungstätigkeit der Bienen Nutzen gezogen.
Neuerdings empfehlen ihnen aber große Saatgutfirmen ein selbstfertiles
Saatgut, das keinen Nektar abgibt, und die Insektenbestäubung nicht
benötigt. Die passenden Insektizide und Herbizide erzeugen
ebenfalls diese Konzerne, deren Gifte mit dem Insektensterben in
Verbindung gebracht werden.
|
| |
|
Neues über Honig, Propolis u.a.
|
Pressemitteilung unter www.pressetext.de/pte.mc?pte-070522046 abrufbar: PROPOLIS
soll gegen das NEUROBLASTOM- eine bösartige Erkrankung des
Nervensystems, die vor allem bei Kindern auftritt. eingesetzt werden.
Projektleiter ist Dr. Peter Reusch an der Ruhr Universität Bochum
www. ruhr-uni-bochum.de/medizin |
Honig wird
verstärkt auch in der Schulmedizin wieder zur Wundbehandlung
eingesetzt: naturbelassenen Honig besitzt - das wußten bereits unsere
Vorfahren- keimtötende und heilende Wirkung. |
Der
Wert der Bestäubungtätigkeit durch die Bienen ist 10 bis 100 fach
(abhängig von der Gegend) höher als der Honigertrag!
Echter
naturbelassener, nie überhitzter Honig kristallisiert früher oder
später! Wann ein Honig kristallisiert, hängt von der
Nektarzusammensetzung ab, also den Blüten, von denen die Bienen den
Nektar sammelten. Kristallisieren ist ein ganz natürlicher Vorgang und
wird oft als „Auszuckern“ bezeichnet. Das hat aber bei "Honig aus
meiner Imkerei" nichts mit dem Zusetzen von Zucker zu tun. Denn in dem
echtem Bienenhonig aus meiner Imkerei ist kein Stäubchen Zucker
enthalten. Gelegentlich kann nach längerer Lagerung sich Honig im Glas
in flüssigen und cremigen Bereich absetzen. Dann haben die Bienen
sowohl schnell und langsam kristallisierenden Nektar gesammelt, der
sich im Glas wieder abgesetzt hat. Das bedeutet keinen Qualitätsverlust.
Kristallisierter Honig kann in einem Wasserbad bei 42 Grad C ohne
Qualitätsverlust wieder verflüssigt werden. Verflüssigen ist auch in
der Mikrowelle möglich, nur verliert der Honig dabei wichtige
Inhaltstoffe.
Honig bitte trocken, vor Wärme geschützt und dunkel lagern.
|
Aktuelle Nachrichten aus aller Welt |
Das
Bienensterben, vom dem die Medien in der letzten Zeit berichteten, und
über dessen Ursachen gerätselt wird, hat oft seine Ursachen in der
mangelhaften und unzeitgemäßen Reduzierung der Varroamilbe durch den
Bienenhalter. Mit dieser Plage muss die Imkerschaft weltweit seit ca 20
Jahren leben. Damals sprang dieser Parasit von der asiatischen auf die
europäische Honigbiene über. Geschwächte Bienenvölker sind auch für
Viruserkrankungen anfälliger. In Europa ist selbstverständlich der
Einsatz von Medikamenten oder Chemikalien zur Vernichtung der Milbe
strengstens verboten.
Hauptsächlich
wird das
Bienensterben in Europa und Übersee aber nachgewiesenermaßen
durch die Anwendung von "intelligenten" Saatgutbeizmitteln, sogenannten
Neonicotinoiden verursacht. Diese entwickeln ihre tödliche Wirkung
gegen Schädlinge im Boden und nach dem Wachsen der Pflanze gegen
Fraßschädlinge. Mit
Gift in Berührung gekommene Schadinsekten, aber auch, Bienen, die
Nektar und Pollen sammeln, sowie Hummeln oder Schmetterlinge
werden getötet oder zumindest stark geschädigt. Dass Gift auch im Ackerboden gespeichert wird , sowie
ins Grundwasser gelangt, wird derzeit von den zuständigen Behörden
hingenommen.
|
|
Warum gibt es in Österreich immer weniger Bienen? |
Wiederholt
sprachen mich in den letzten Monaten Honigkunden darauf an, dass sie
weder auf den Obstbäumen, noch auf den Blumenwiesen Honigbienen
entdecken konnten. Es ist traurig aber wahr: die älteren Imker hören
mit der Bienenhaltung auf. Dabei werden Imker im Durchschnitt älter,
weil sie viel in der Natur sind und sich von den verschiedenen
Bienenprodukten ernähren. Der Imkernachwuchs muss erst gefunden und
begeistert werden. Zur Zeit können wir feststellen, dass sich schon
junge Männer, aber
auch Frauen, aber auch jene, die sich dem Pensionsalter nähern,
Imkerkurse besuchen. Es
gibt kein interessanteres Hobby als die Imkerei. Für Kinder sollte die
Aufklärungsarbeit über Bienenhaltung aber schon in der
Schule beginnen. Es ist es nicht schwer, Imker zu werden. Kontaktieren Sie im Internet die Imkerverbände der Bundesländer oder ggfs. mich, ich gebe Ihnen gerne Ratschläge.
|